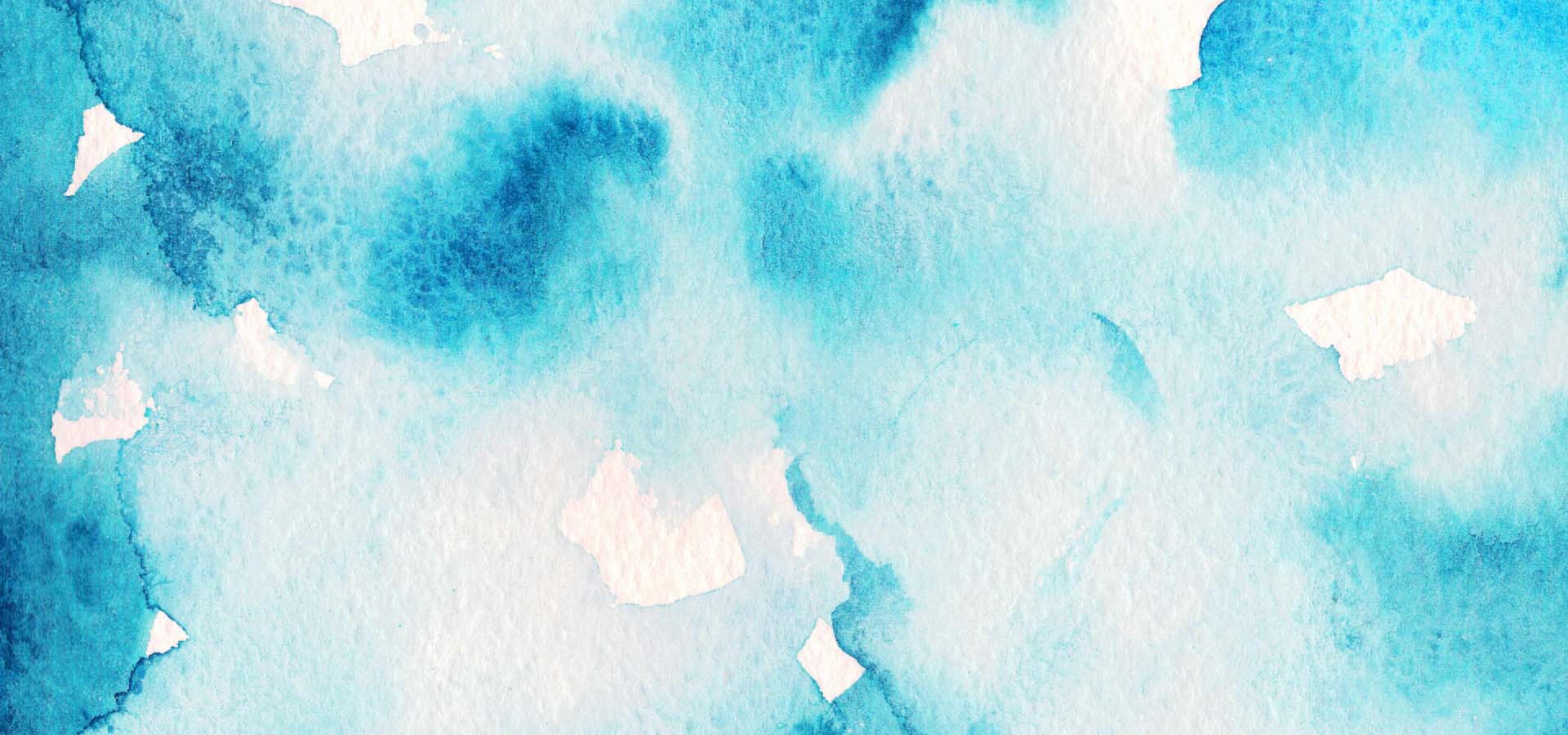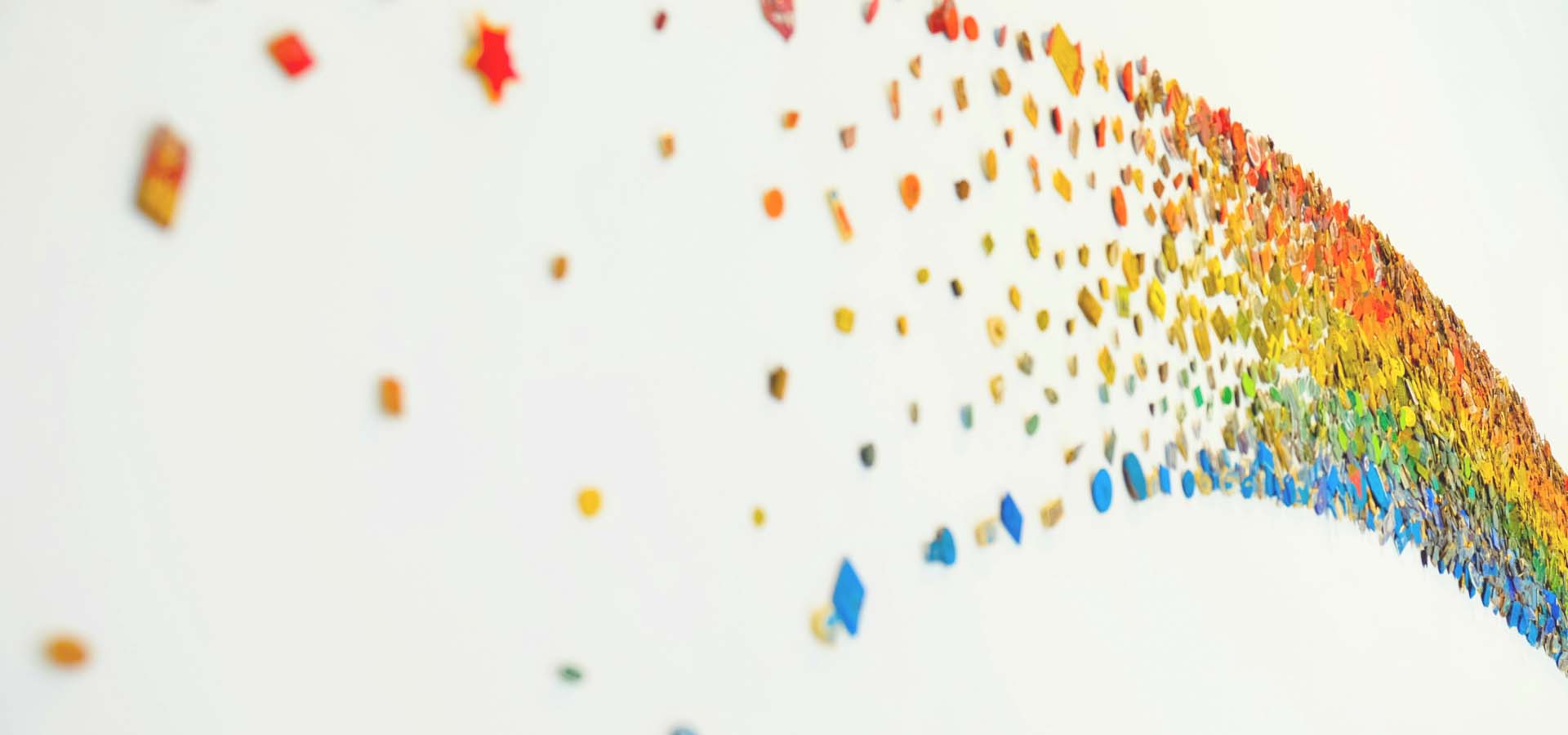Allgemeine Geschichte des 19./20. Jhds (Professur Arni)
Projects & Collaborations
Stunde der Frauen, Zeit der Mütter. Geschichtsbezüge und Zukunftsentwürfe im "Frauenaufbruch" 1945 bis 1949"
Research Project | 1 Project Members
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich in Deutschland zahlreiche Frauen in Ausschüssen und Organisationen zusammen und formulierten einen politischen Anspruch: Die Erfahrung der „Männerherrschaft“ des Faschismus begründete ihre Forderung nach einer gesellschaftlichen Neuordnung in Frauenhand. Die Akteurinnen dieses „Frauenaufbruchs“ der Jahre 1945 bis 1949 stehen im Zentrum des Forschungsprojekts.
In diesem Forschungsprojekt von Anna Leyrer soll die Geschichte der „alten“ Frauenbewegungen mit Höhepunkt um 1900 mit der „neuen“ Bewegung nach 1968 verknüpft werden: Es werden Kontinuitäten über die Zäsur des Nationalsozialismus hinweg in den Blick genommen. Dabei haben die am „Frauenaufbruch“ beteiligten Frauen selbst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsentwürfe miteinander in Bezug gesetzt. Insbesondere in ihrer Rolle als (potentielle) Mütter und als Töchter sahen sich die Frauen für Vergangenheit wie Zukunft verantwortlich. Das Projekt fragt danach, wie es mit dem Bezug auf ein Kollektiv der „Frauen“ und „Mütter“ gelang, Allianzen über ideologisch-politische Trennlinien hinweg herzustellen.
Bild: Demo am 1. Mai 1946 in Berlin. - Foto: © Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz/bpk-Bildagentur