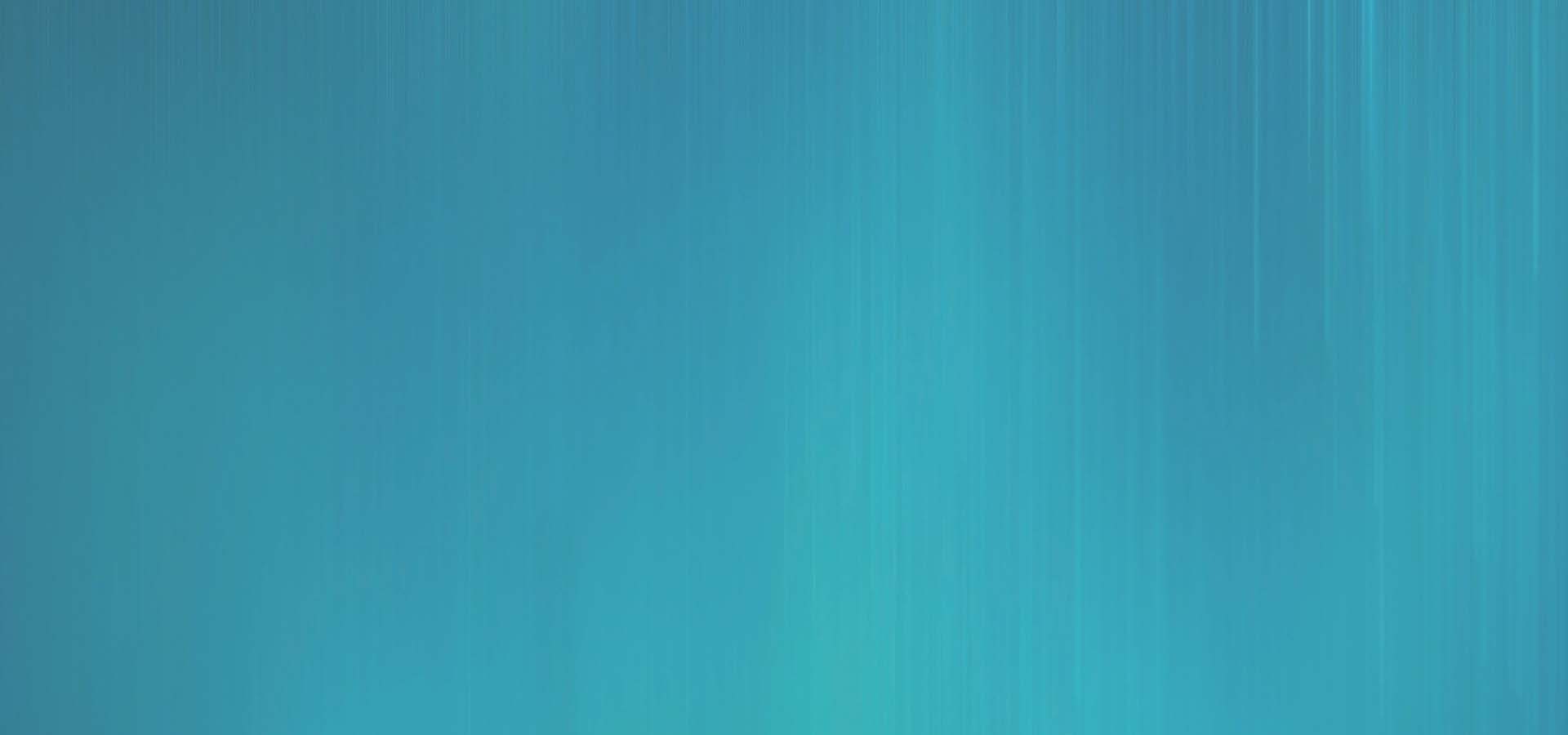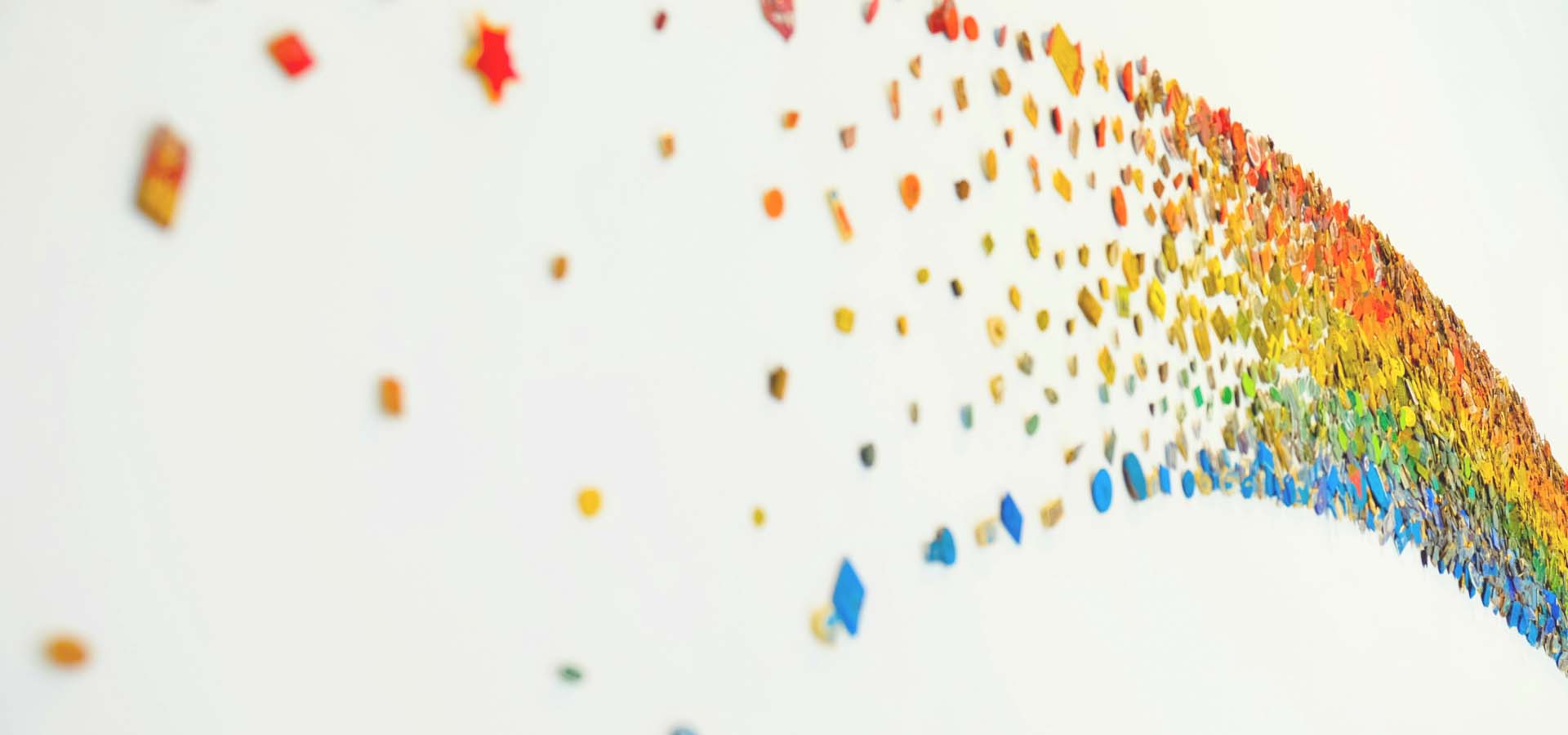Projects & Collaborations

Sustainable improvement of INTERprofessional care for better resident outcomes: SCAling up an Evidence-based care model for nursing homes (INTERSCALE)
Research Project | 16 Project Members
Langzeitpflegeinstitutionen stehen vor der Herausforderung, eine qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung unter schwierigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Fachkräftemangel, enge finanzielle Bedingungen und der teilweise fehlende Zugang zu geriatrischer Expertise sind Herausforderungen, die neue Lösungswege erfordern. In diesem Kontext wurde das pflegegeleitete Versorgungsmodell INTERCARE entwickelt und erfolgreich in elf Deutschschweizer Pflegeinstitutionen zwischen 2018 und 2020 eingeführt.
Die sechs Kernelemente des Modells umfassen: 1) Einführung einer Pflegefachperson in einer erweiterten Rolle (INTERCARE Pflegefachperson), 2) Stärkung des interprofessionellen Behandlungsteams, 3) Einführung von evidenzbasierten Instrumenten zur Stärkung der Kommunikation innerhalb vom Pflegeteam und mit Ärzt:innen, 4) Einsatz des multidimensionalen geriatrischen Assessments, 5) Umsetzung der gesundheitlichen Vorausplanung, 6) datenbasierte Qualitätsentwicklung.
Eine detaillierte Beschreibung des Modells, respektive eine Zusammenfassung der Ergebnisse der INTERCARE Studie finden Sie hier im ersten und zweiten nationalen Bericht.
Die INTERCARE-Studie zeigte positive Ergebnisse, darunter weniger ungeplante Spitaleinweisungen und mehr Bewohnende mit einer gesundheitlichen Vorausplanung. In den teilnehmenden Betrieben erlebten die Pflege- und Betreuungsteams mit der Einführung der neuen Rolle ein Empowerment. Das Modell führte zu einer gesteigerten Fachkompetenz, mehr interprofessionellem Austausch und weniger Reklamationen von Bewohnenden. Die begleitende Evaluation belegt hohe Akzeptanz, und auch zwei Jahre nach Projektende wird INTERCARE in 10 der 11 Pflegeinstitutionen umgesetzt.
Die Einführung von INTERCARE ist ein aktiver Organisationsentwicklungsprozess, der durch Implementierungsstrategien unterstützt wurde. Diese umfassten Einführungsveranstaltungen, regelmässige Coachings für die Führungsteams, ein Ausbildungsprogramm (heute das CAS INTERCARE) und Coachings für die INTERCARE Pflegefachperson, Feedback und Benchmarking zu Qualitätsindikatoren sowie bereitgestellte Materialien für die Einführung.
Die Implementierungsstrategien wurden als entscheidend für den Erfolg der INTERCARE-Einführung betrachtet, insbesondere regelmässige Treffen und Coaching.
Ziel
Um INTERCARE künftig breitflächig einführen zu können, möchten wir in Erfahrung bringen, welche Implementierungsstrategien in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis liegen. In der Folgestudie INTERSCALE wird untersucht, welche Implementierungsstrategien die Pflegeinstitutionen effizient bei der Umsetzung eines neuen Versorgungsmodell unterstützen und was die Einrichtungen selbst für eine nachhaltige Implementierung tun können. Ziel ist es, herauszufinden welche Kombination von Implementierungsstrategien gleicherweise zur erfolgreichen Reduktion von Spitaleinweisungen und zur nachhaltigen Umsetzung von INTERCARE führt und dabei (zeitliche, personelle, finanzielle) Ressourcen schont.
Ablauf der Studie
Das Projekt besteht aus zwei Arbeitspaketen, die sich über 5 Jahre erstrecken (2022 – 2027):
Mehr Details zu den Arbeitspaketen finden Sie auf unserer Website.
Arbeitspaket 1: Partizipative Entwicklung von Implementierungsstrategien (2022 – 2023)
Im Arbeitspaket 1 der INTERSCALE-Studie wurde das bestehende INTERCARE Modell und die Implementierungsstrategien überprüft und aktualisiert (z. B. Anpassung der Unterrichtsinhalte für die INTERCARE Pflegefachpersonen, Update von Informationsmaterialen für teilnehmende Pflegeinstitutionen). Zudem wurde ein neues Bündel an Implementierungsstrategien entwickelt, das im Arbeitspaket 2 mit dem bisherigen verglichen werden kann bezüglich der Kosteneffizienz. Die Aktualisierung erfolgte in Zusammenarbeit mit Pflegeinstitutionen und Stakeholdern aus dem ersten Durchgang sowie neuen Interessenten, einschließlich Vertretungen aus Politik, Behörden, Leistungserbringenden, Berufsgruppen und Bewohnendengruppen.
Arbeitspaket 2: Implementierung von INTERCARE und Evaluation der Implementierungsstrategien (2023 – 2027)
Im Arbeitspaket 2 wird das Versorgungsmodell in 40 Pflegeinstitutionen in der deutschsprachigen Schweiz implementiert, im Rahmen einer cluster-randomisierten kontrollierten Studie. Alle teilnehmenden Pflegeinstitutionen werden bei der Einführung von INTERCARE mit verschiedenen Implementierungsstrategien begleitet (z. B. zur Verfügung stellen von Hilfsmitteln, Coaching, Feedback zu Qualitätsindikatoren). Dabei werden zwei verschiedene Bündel an Implementierungsstrategien verglichen. Beide Gruppen erhalten die INTERCARE-Intervention, wobei eine Gruppe das aktualisierte Bündel an Implementierungsstrategien einsetzt, während die andere das neu entwickelte adaptierte Bündel einsetzt. Die Vorbereitungen mit den ersten interessierten Betrieben starten im Herbst 2023, somit starten die ersten Betriebe mit der Umsetzung des Modells im Frühling 2024. Der Start ist gestaffelt, es ist während dem ganzen Jahr 2024 möglich, in die Studie einzusteigen, so lange noch Plätze offen sind. Die Studienteilnahme dauert 24 Monate (12 Monate Einführung und Umsetzung von INTERCARE unter Begleitung, 12 Monate Weiterführung).
Die Studie untersucht die Wirksamkeit, Kosten, Akzeptanz und Nachhaltigkeit der unterschiedlichen Bündel an Implementierungsstrategien. Darüber hinaus werden auch klinische Ergebnisse, d.h. Anzahl ungeplanter Spitaleinweisungen, und Ergebnisse auf Organisationsebene wie Personalfluktuation oder Absentismus gemessen.
Erwarteter Nutzen
INTERSCALE erlaubt evidenzbasierte Aussagen zu generieren, wie Pflegeinstitutionen kosteneffizient unterstützt werden können, um ein pflegegeleitetes Versorgungsmodell wie INTERCARE erfolgreich zu implementieren. Der partizipative Ansatz ermöglicht die Entwicklung von Implementierungsstrategien, die für das Deutschschweizer Langzeitpflegesetting passend sind und eine hohe Akzeptanz bei den Pflegeinstitutionen haben. Die Studie wird einen öffentlich zugänglichen Bericht mit der Beschreibung und Auswertung der verschiedenen Implementierungsstrategien erstellen. Diese Erkenntnisse erlauben der Politik, Leistungserbringerverbänden und anderen Organisationen, Pflegeinstitutionen optimal bei der Stärkung der Pflegeexpertise und der Weiterentwicklung der Pflegequalität zu unterstützen, um sich gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu stellen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Prof. Dr. F. Zúñiga.