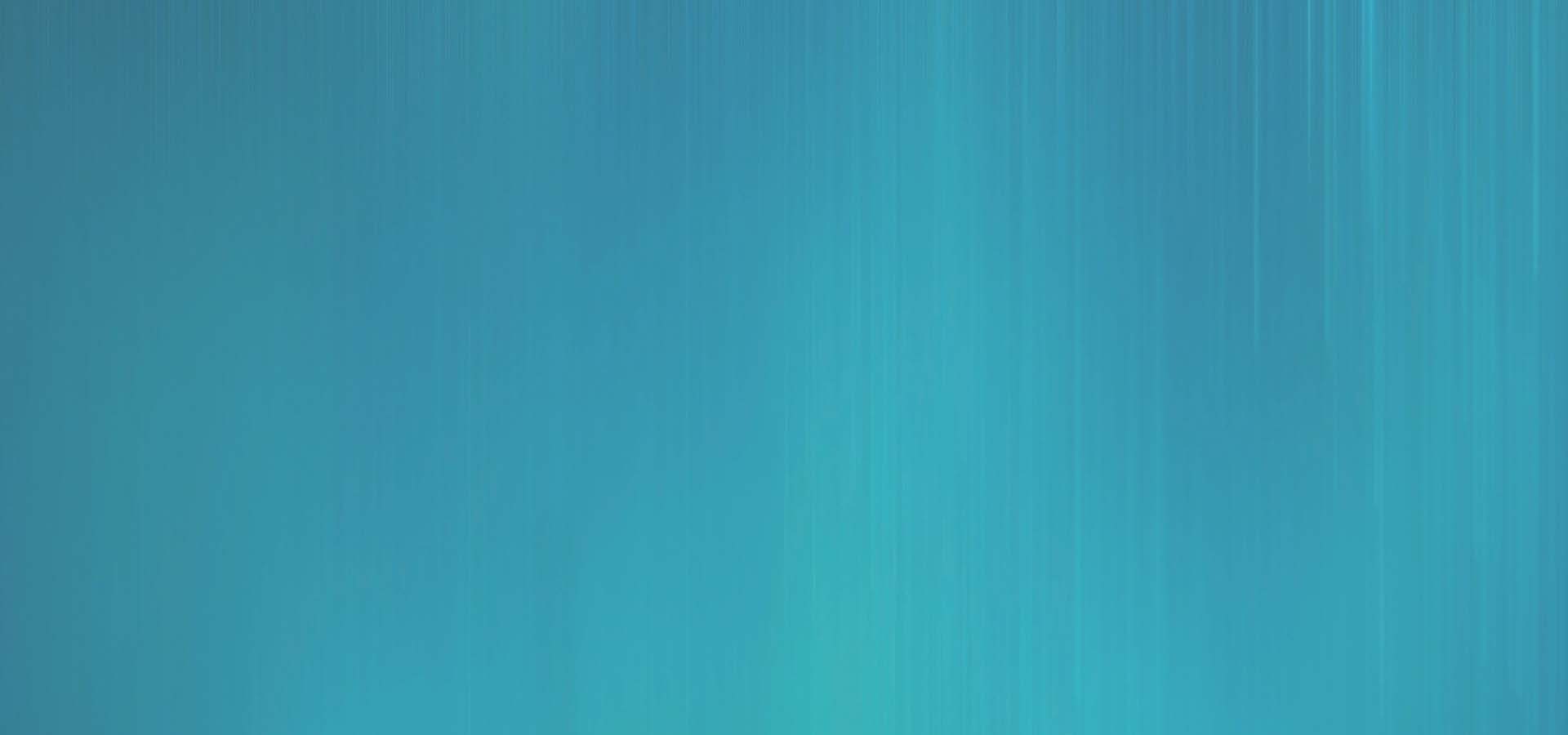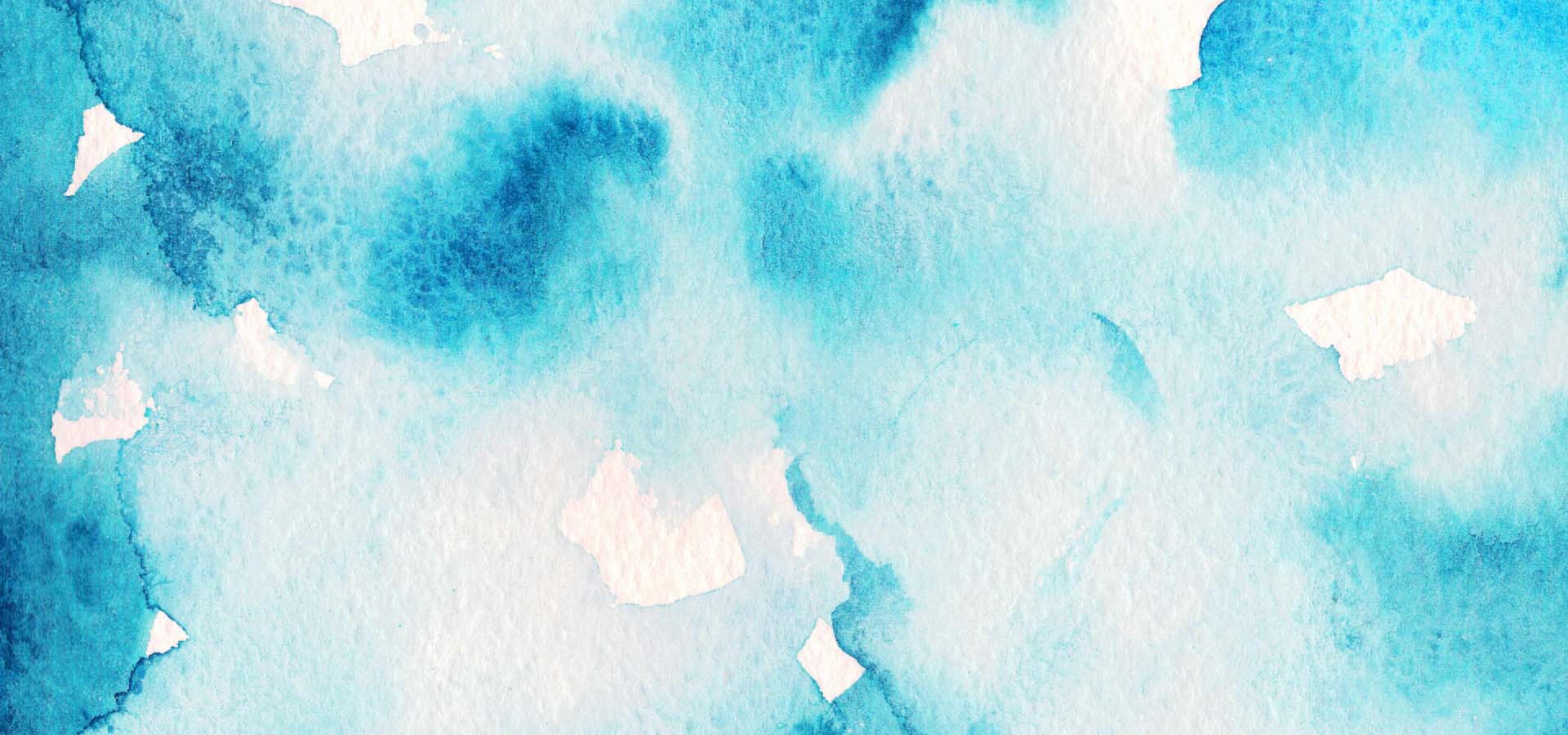Department of Ancient Civilizations
Projects & Collaborations
NOMAD – Naher Osten, Mesopotamien, Ägypten im Diskurs
Research Networks of the University of Basel | 22 Project Members
Das universitäre Forschungsnetzwerk «NOMAD – Naher Osten, Mesopotamien, Ägypten im Diskurs» vernetzt Forschungen zum östlichen Mittelmeerraum, Mesopotamien und Ägypten an der Universität Basel und fördert den Austausch mit der Öffentlichkeit. Im westasiatischen Raum (ca. 10. Jt.v.u.Z. bis 7.Jh.u.Z.) entstanden sesshafte Lebensweisen, Ackerbau, Viehzucht, urbanes Leben, Schriftsysteme, Industrien und Wissenschaften sowie die religiösen Traditionen von Judentum, Christentum und Islam. Ohne Berücksichtigung der Geschichte Westasiens lassen sich relevante Prozesse der Weltgeschichte nicht verstehen. Themen aus dem Bereich des Nahen Osten sind seit Jahrzehnten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft relevant, national und international omnipräsent und werden es weiterhin bleiben.
In der Region Basel setzen sich zahlreiche Forschende und Institutionen mit Kulturen, Zeiten, Regionen, Religionen und Sprachen des Nahen Ostens, Mesopotamiens und Ägyptens auseinander. NOMAD hat zum Ziel, diese Kompetenzen und Angebote zu bündeln. NOMAD fördert den für Wissenschaft wie Öffentlichkeit wichtigen Austausch über kulturhistorische, aktuelle und fachübergreifende Themen zwischen (Nachwuchs-)Forschenden, Studierenden und der breiteren Öffentlichkeit.
Am Forschungsnetzwerk beteiligt sind Forschende der Theologischen Fakultät, des Departements Altertumswissenschaften, der Nahoststudien, des Zentrums für Jüdische Studien und der Integrativen Prähistorischen und Naturwissenschaftlichen Archäologie (IPNA) der Universität Basel sowie das Antikenmuseum Basel.
The university research network «NOMAD – Near East, Mesopotamia, Egypt in Discourse» connects research at the University of Basel focused on the Eastern Mediterranean, Mesopotamia, and Egypt, and promotes dialogue with the public. In West Asia (approx. 10th millennium BCE to 7th century CE), key developments emerged, including settled ways of life, agriculture, animal husbandry, urbanization, writing systems, industries and sciences, as well as the religious traditions of Judaism, Christianity, and Islam. Understanding major processes in world history is impossible without considering the history of West Asia. Topics related to the Near East have long played a crucial role in politics, economics, and society – both nationally and internationally – and will continue to do so.
In the Basel region, numerous researchers and institutions engage with the cultures, periods, regions, religions, and languages of the Near East, Mesopotamia, and Egypt. NOMAD aims to bring together these areas of expertise and offerings. The network fosters interdisciplinary exchange on cultural-historical, contemporary, and academic topics among (early-career) researchers, students, and the wider public – an exchange essential to both scholarship and society.
The research network includes researchers from the Faculty of Theology, the Department of Ancient Civilizations, Near and Middle Eastern Studies, the Center for Jewish Studies, the Integrative Prehistory and Archaeological Science (IPAS) at the University of Basel, and the Antikenmuseum Basel.